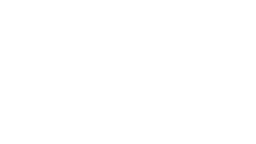Jetzt lesen
Transkript zu Episode 3: „Diversität ist kein Schalter, den man drücken kann. Es ist ein Prozess.“
Auf dem Weg zu mehr Diversität zählt jeder Schritt. KiKA ist da schon weit gekommen, finden Ferda Ataman und Dr. Maria Furtwängler. Was sollten die nächsten Ziele sein?
Maria Furtwängler: Wie ich zum ersten Mal, das ist glaub ich 15 Jahre schon her, im Flieger von München nach Berlin saß, und plötzlich eine Kapitänin sprach und sagt: Meine Damen und Herren, herzlich Willkommen. Ich flieg Sie jetzt nach Berlin. Und ich nur – mein Reflex war – scheiße, wie komm ich hier raus. Und ich nur schockiert von mir selbst war. Ich sagte, ja Maria. Natürlich kann das eine Frau. Jaja, intellektuell und ich bin für Gleichberechtigung. Aber wenn es an den Moment der Ohnmacht, des Fliegens geht, da habe ich doch keine Frau im Kopf, die ein Flugzeug steuern kann. In jedem amerikanischen Spielfilm waren das immer Männer, die in letzter Sekunde durch den Sturm das Ding noch gelandet haben. Und in jedem Kinderbuch sind es Männer. Ich bin doch ein Produkt dieser Gesellschaft.
[Intro] „Generation Alpha – Der KiKA-Podcast“
Daniel Fiene: Herzlich willkommen zur nächsten Reise in die Zukunft. In eine Zukunft, bei der wir uns fragen: In was für einer Gesellschaft werden unsere Kinder in 25 Jahren aufwachsen? Ich nehme sie gerne mit. Mein Name ist Daniel Fiene. Danke fürs Hören.
Unser heutiges Etappenziel: Diversität. Denn Vielfalt ist ein zentraler Wert für KiKA. Deswegen beschäftigen uns auch in dieser Episode hier im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen KiKA-Bestehen. Und ich habe ihnen das mal aus der Selbstbeschreibung rausgesucht, wie Vielfalt in den Sendungen, aber auch im Umgang mit Mitarbeiter*innen und Partner*innen gesehen wird. Ich lese es mal vor, hier Zitat: Divers leben mit Blick auf Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder Religion ist Normalität. Mit unserem Programm geben wir verschiedenen Lebensentwürfen Raum, ohne bewertend zu sein und bieten Raum für Orientierung und Diskussion. Tja, und diesen Raum für Diskussionen, den nutzen wir jetzt in diesem Podcast. Ich freue mich auf zwei Medienprofis, die neben ihrer regulären Arbeit sich intensiv seit Jahren für das Thema Diversität in den Medien und in der Gesellschaft einsetzen. Zu Gast ist die Journalistin Ferda Ataman. 2009 hat sie die „Neuen deutschen Medienmacher*innen“ mitgegründet, um Redaktionen und ihre Berichterstattung vielfältiger zu machen. Bei der Gründung hat sie übrigens noch Sätze gehört wie: „Wir haben jetzt auch eine Türkin in der Redaktion“. Aber wir schauen jetzt lieber in die Zukunft. Wie soll Diversität in 25 Jahren gelebt werden? Ferda Ataman hat uns Ihre Vision mitgebracht.
Ferda Ataman: Also Kinder. Wenn sie rauskommen von Zuhause, dann sind sie ja als Erstes der Gesellschaft in Berührung, in der Regel in so Einrichtung wie der im der Kita oder dem Kindergarten und dann der Schule. Ich würde mir wünschen, dass Kinder in 25 Jahren eine Welt vorfinden, in der sie wissen, dass egal wie sie heißen, egal wie sie aussehen, egal was ihre Eltern machen, egal ob sie Geld haben oder nicht, also im Sinne von wohlhabend. Ob die Eltern arbeiten oder vielleicht arbeitslos sind, dass sie die gleichen Chancen haben, alle. So. Und dass sie positiv und selbstbewusst in die Welt blicken können und sagen kann okay: ich lern jetzt was. Und zweitens gucke ich mal, wo ich hin will. Das setzt aber voraus, dass man weiß, dass es heute halt nicht so ist. Also viele denken, glaube ich, dass es so ist, weil die die, denen es gut geht, die denken, dass es allen gut geht. Das ist immer so in der Welt. Aber es gibt eben viele Kinder und Jugendliche, die wegen ihres Namens oder ab einem gewissen Alter auch als Geschlecht, also auch Frauen. Und natürlich, auch wenn Kinder eine Behinderung haben oder vielleicht noch gar nicht Deutsch können, weil die Eltern erst vor einem Jahr nach Deutschland gekommen sind. Und und und. Also es gibt ja viele Gründe, warum Kinder schwierige Startbedingungen haben, dass diese Startbedingungen kein Hindernis mehr sind. Das wäre ein Idealzustand. Und ich glaube, wir sind auf einem besseren Weg dahin. Aber da muss auch noch viel passieren, damit Kinder immer die gleichen Chancen haben.
Daniel Fiene: Die Runde ergänzt Maria Furtwängler, Schauspielerin, Produzentin und Co-Gründerin der MaLisa-Stiftung. 2016 hat sie mit ihrer Tochter Elisabeth die Stiftung gegründet. MaLisa engagiert sich auf internationaler Ebene für die Beendigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und hier in Deutschland setzte sich auch für gesellschaftliche Vielfalt und die Überwindung einschränkender Rollenbilder ein. Dazu gibt es Studien zur Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche, aber auch zu Rollenbildern in den Medien. Auch in fiktionalen Programmen. Maria Furtwänglers Vision setzt die von Ferda Ataman fort, ist dabei aber nicht ausschließlich optimistisch.
Maria Furtwängler: Natürlich würde ich mir wünschen, dass es das dann in einer Welt ist, wo diese Gleichberechtigung von den Medien verstärkt wird. Auch von der Politik, vom Bildungssystem. Vielleicht, dass die Kinderrechte-Konvention der UNO umgesetzt ist. Und ich würde mir auch wünschen, dass dann alle Kinder, die geboren sind, gewünscht sind von ihren Eltern. Aber und das ist mein großes aber, das kommt natürlich extrem darauf an, ob es uns irgendwie gelingt, die Klima oder Biodiversitätsziele irgendwie einzuhalten. Also nicht über 1,5 Grad oder zumindest nicht über zwei Grad zu kommen. Und sonst ja, werden Kinder vielleicht in einer Welt leben, in der ihr Alltag geprägt ist von Dürren, von Kriege um Wasser, von Flutkatastrophen, von Migration, von steigenden Meeresspiegeln. Also es gibt in mir, ich sage es ganz ehrlich auch eine sehr düstere Vision und eine unglaubliche, damit verbundene, auch Scham fast, dass ich Teil dieser Generation bin, die den größten Anteil am CO2 Output hatte, seit dem Beginn der der Industrialisierung. Und wir das viel zu lange sehenden Auges zugesehen haben und eigentlich immer noch tun. Also es gibt in mir auch, es gibt die hoffnungsvolle Seite. Und dann gibt es düstere Tage, wo ich denke: Wow, was hinterlassen wir den Kindern hier? Und dann natürlich ist es ein Riesenunterschied und ich würde mir wünschen, dass es dann keinen Unterschied mehr macht, ob ein Kind in Deutschland geboren ist oder in Indonesien oder sonst wo. Aber das ist sicher noch ein sehr weiter Weg.
Daniel Fiene: Die beiden kennen und können die großen Medien, sind ja Podien und Fernseh-Talkshows gewohnt. Wie kriegen wir aber jetzt einen Raum für Austausch hin, um die nötige Tiefe für das Thema Diversität hinzubekommen? Zur Auflockerung habe ich beiden angeboten, sie so zu begrüßen, wie andere Promis ihre Gäste im eigenen Podcast begrüßen. Entweder wie Markus Lanz das tut oder Barbara Schöneberger. Tja und die beiden, die wilden, ich sage es mal so: divers.
Ferda Ataman: Ich hätte gern Markus Lanz.
Maria Furtwängler: Auch da würde ich mir die Variante Schöneberger vornehmen.
Daniel Fiene: Ja, dann mach ich das individuell. Hier ist die Variante Lanz: Ja, guten Morgen, Ferda.
Ferda Ataman: Guten Morgen, Daniel.
Daniel Fiene: Wo erwische ich dich gerade?
Ferda Ataman: Ich bin tatsächlich im Schrank mit dem Kopf, weil hier die Aufnahmequalität am besten ist. Aber zuhause, da, wo ich immer gerne arbeite.
Daniel Fiene: Wo ist denn Zuhause?
Ferda Ataman: Zuhause ist in Berlin, in einem schönen Stadtteil, in einem schönen Altbau. Ziemlich zentral in Berlin wohne ich.
Daniel Fiene: Das ist das gleiche Understatement, das sich von Barack Obama gewohnt bin. Habe ich zuletzt bei einem persönlichen Treffen noch bewundert.
So ich glaube, es reicht jetzt an Markus Lanz. Maria Furtwängler, sie haben sich Barbara Schöneberger gewünscht. Oh, ja dann los. Ladies und Gentlemen. Sie ist da, die unvergleichliche Maria Furtwängler.
Maria Furtwängler: Hallo Daniel.
Daniel Fiene: Ich freue mich endlich mal kein Gast, der hier einfach nur sein Instagram-Channel oder Podcast promoten will.
Maria Furtwängler: Ach, du wirst dich wundern. Daniel, da kommt noch was.
Daniel Fiene: Das hat irgendwie geklappt. So gut, dass beide direkt in das Du zur Diskussion wechseln wollten. Okay, machen wir das so. Tatsächlich habe ich beide schon oft zum Thema Diversität sprechen hören oder gelesen. Maria Furtwängler sagte im letzten Jahr, wenn wir das aktuelle Tempo beibehalten, Leben wie erst in 258 Jahren in einer gleichberechtigten Welt. Wenn wir Diversität als Prozess betrachten, wo stehen wir denn da heute? Darum geht es jetzt zum ersten Gesprächsteil. Und zunächst wollte ich aber wissen, welche Fragen in Sachen Diversität den beiden denn noch nie gestellt wurde.
Ferda Ataman: Eine Frage, die mir noch nie gestellt wurde. Und ich finde, das ist eigentlich so die grundsätzliche Frage, ist tatsächlich eine ganz ehrliche, und zwar: Wozu eigentlich überhaupt? So alle tun immer so, als wäre es ihnen total klar. Und als hätten sie schon alle diesen Idealzustand und einmal kurz zu fragen - ja das was zum Beispiel die MaLisa-Stiftung macht. Gleichstellung von Frauen, beziehungsweise geschlechtergerechte Berichterstattung. Wozu ist sie eigentlich gut? Ich finde diese ehrliche Frage. Die würde vielen gut zu Gesicht stehen und die meisten fragen erst gar nicht. Sondern tun so, als wüssten sie es, machen es aber trotzdem nicht.
Daniel Fiene: Und wie würdest du es beantworten?
Ferda Ataman: Wozu? Na ja, früher haben wir immer viel argumentiert mit: Es ist gerechter. Und es ist fair, wenn man alle zu Wort kommen lässt. Und das gehört sich so, demokratisch und so weiter. Und heute sagen wir eigentlich nur noch: erstens guter Journalismus und gute Berichterstattung, und übrigens auch gute Filme und gute Unterhaltung, müssen divers sein, weil sie sonst sehr einseitig sind und eben nicht die Lebenswirklichkeit von Menschen widerspiegeln. Also Menschen wollen sich ja wiedererkennen im Fernsehen, aber auch in den Zeitungen, im Radio. Und wenn sie das nie tun, dann schalten die halt ab. So. Das heißt das eine ist, dass es einfach ein besserer Journalismus ist. Und das andere ist, dass man dadurch auf Dauer in Deutschland Reichweite erhalten kann. Die Gesellschaft ist halt so wie sie ist - nämlich ziemlich divers. Also muss man das auch abdecken und bedienen.
Daniel Fiene: Womit wir schon inhaltlich im Thema drin sind. Maria auch: Welche Frage wurde dir da denn noch nicht gestellt? Und welche würdest du da gerne auch beantworten?
Maria Furtwängler: Ich kann mich eigentlich dem was Ferda gesagt hat durchaus anschließen. Diese Frage, ja wozu eigentlich? Ich finde die sehr gerechtfertigt. Auch uns wurde sie nie gestellt. Weil es ja auch so, im Sinne, ja klar. Männer und Frauen sollten gleichberechtigt sein. Ist ja eh logisch, irgendwie. Aber warum eigentlich? Da geht es mir ganz ähnlich. In dem Verlauf, was auch so der Antrieb. War ganz stark: Hey, weil es einfach ungerecht ist. Also jetzt wiederum auf Medien bezogen. Was ja auch unser Kernthema ist. So im Sinne, ja, aber wir sind die Hälfte der Gesellschaft. Warum kommen wir nicht zur Hälfte vor. Das ist ja eine subtile Form von Unterdrückung letztendlich auch. So diese Unsichtbarmachung von Frauen. Frauen verschwinden im Alter etc. Mittlerweile hat das noch dazu für mich eine ganz andere Bedeutung. Auch eine andere Dimension. Nämlich die, dass ich glaube, das viele der Probleme, die wir heute haben, nicht mehr von einer ausschließlichen oder größtenteils männlichen, weißen Welt gelöst werden können. Ich glaube, dass die Probleme, die wir haben, vielfältig und so unglaublich herausfordernd sind. Jenseits von Gerechtigsfragen, Klima-Thema, Diversitätsverlust, natürlich das Pandemie-Thema. Ich finde wir haben das gerade in der Pandemie, in der Corona Berichterstattung, aber auch in der Reaktion darauf auch gemerkt. Zwar wurde die Pflege, größtenteils auch Pfleger*innen, und den Kassierer*innen häufig applaudiert. Und mein Gott, und Stütze der Gesellschaft. Sie haben seitdem nach wie vor nicht mehr Geld bekommen. Muss man dazu sagen. Die wurden auch nicht an die Entscheidungstische gebeten. Es wurden die Mütter mit den Kindern zuhause. Sie waren nicht Teil der Leopoldina-Expertenkommission. Da waren glaube ich 25 Männer und zwei Frauen. Also wo man sich immer wieder fragt, wir haben das ja auch analysiert, wie viele Männer und Frauen kommen im Bezug zu Corona zu Wort? Auf der Ebene der Expert*innen. Das wir bei den Herausforderungen, die wir heute haben, mit der bisher her doch sehr, sehr majoritär männlichen, weißen Perspektive alle Lösungen denken werden.
Daniel Fiene: Was mir aufgefallen ist, dass ihr das beide auch als Prozess beschrieben habt. Als langen Prozess. Und tatsächlich ist es ja so, glaube ich, Diversität. Das ist kein Schalter, den man drücken kann. Wenn man das als Prozess sieht, wo würdet ihr sagen stehen wir denn da heute in unserer deutschen Gesellschaft, in der Mediengesellschaft?
Maria Furtwängler: Wie du eben sagtest Daniel. Wir sind eben in einem Prozess, der auch, da bin ich schon gleich bei einem sehr schwierigen Thema, auch eine gewisse Übersteuerung und Übersensibilisierung bringt, von der ich zum Teil glaube, dass sie auch nicht hilfreich ist. Weil sie auch aggressiv macht. Wenn man das Gefühl hat, bestimmte Dinge sollte man nicht mehr sagen. Aber wird das irgendwann einengend. Und dann verstehe ich eigentlich auch nicht warum. Aber ich glaube aber, dass es wie so eine, das ist vielleicht wie so etwas, das man gerade einmal in Kauf nehmen muss. Das es vielleicht hier und da mal so eine Übersteuerung gibt. Und dass es irgendwann, also nicht irgendwann sondern ich glaube sogar in relativ naher Zukunft, man einen normaleren Umgang damit finden wird. Ist mein Dafürhalten. Ich weiß nicht, ob ich sehr ungenau bin. Ich fürchte ja.
Daniel Fiene: Wenn wir jetzt tatsächlich in die Zukunft blicken, da ist mir bei der Vision einfach noch im Ohr, dass wir da vielleicht erst mal jetzt anhalten müssten und sagen es lohnt sich gar nicht, über Diversität zu reden. Erstmal müssen wir das Klimaproblem lösen. Auf der anderen Seite habt ihr gerade schon erwähnt, naja, in vielen Problemlösungen werden bisher eher weiße und vor allen Dingen auch Männer gehört.
Maria Furtwängler: Das ist in den meisten Ländern, die Regierungschefs sind sehr mehrheitlich Männer. Und man denkt dann auch an Regierungen, die erzkonservativ sind auch. Und das kommt immer auch mit einer latenten Leugnung von Klimawandel oder Klimakatastrophe und immer auch antifeministischen Tendenzen. Denken sie an Erdogan, denken sie an Bolsonaro. An Trumps Amerika, als er noch an der Macht war. An Putin. Das sind alles Männer. Und insgesamt ist natürlich, wenn man so will, das ganze kapitalistische System auch sehr stark mit dem Patriarchat verknüpft. Ich bin eben nicht ganz überzeugt, dass was als Grundregeln dessen, was ein gelungenes, ein glückliches Leben oder auch ein gesunder Staat ist, dass diese Definition, die bisher galt, nämlich in erster Linie auch Wachstumsindizes. Dass diese Indizes für die Zukunft, die maßgebenden sein werden.
Ferda Ataman: Wir wissen zum einen das ja die Erderwärmung insbesondere Menschen betrifft in Ländern im Süden, also eben nicht Europa. Nicht unbedingt in New York und sonst wo, sondern eben in Afrika, in Asien und vielen anderen Ländern, wo eben Menschen, die wir, wenn sie hierher wandern, als People of Colour bezeichnen. Das ist das eine. Das andere, das auch hier in Deutschland zum Beispiel, wenn man mal auf einer Fridays for Future Demo war, wo ja überwiegend Kinder und Jugendliche sind, vor allem Jugendliche. Dann sieht man da ja auch ganz viele Menschen mit Migrationsvordergrund. Das liegt daran, dass in Deutschland sowieso 40 Prozent aller Kinder und Jugendlichen aus Einwandererfamilien jetzt schon stammen. Und wenn man dann noch mal guckt, wer lebt in den Städten und in den Ballungszentren, dann sind es dort fast überall schon mindestens 50 Prozent aller Kinder und Jugendlichen. Und so sieht dann auch so eine Demonstration aus. Das heißt, die ganze Bewegung ist eine sehr diverse Bewegung mit Blick auf Migrationsgeschichte. Und es ist leider so, dass viele denken, das sei so ein bisschen so eine ganz weiße Geschichte. Also das da irgendwie Migrantenkinder oder Kinder aus Einwandererfamilien überhaupt nichts mit zu tun hätten. Aber das ist Quatsch. Also sowohl betrifft es weltweit ganz viele Menschen, die nicht weiß sind. Und in Deutschland engagieren sich auch ganz, ganz viele Menschen eben aus Einwandererfamilien. Und das sichtbar zu machen, das wäre wichtig, finde ich. Also dann als Journalist*innen zum Beispiel, wenn man über Demonstration berichtet, da auch hinzugehen. Und eben nicht nur, ich sage jetzt mal Niklas und Mona, sondern eben auch Ahmed und Sanjay zu fragen, warum sie da demonstrieren. Das wäre schön.
Daniel Fiene: Das Thema sichtbar machen ist ja glaube ich auch grundsätzlich heute eine Herausforderung, wenn wir gleich mal gucken: Okay, was können wir in konkret tun? Das fängt ja schon auch einfach daran an, dass Diversität jetzt eben nicht nur bei sichtbaren Merkmalen auszumachen ist. Es gibt ja auch Merkmale, die sind erstmal augenscheinlich nicht sichtbar. Wie komplex ist Diversität?
Ferda Ataman: Im unsichtbaren Bereich bis zuzuschauen? Okay, tatsächlich muss man vielleicht erst mal sagen, wenn wir Diversität sagen, dann denken ja viele Menschen verschiedene Sachen. Manche denken nur an Geschlecht, also nur an Jungen und Mädchen, Männer und Frauen. Oder eben auch nicht-binäre Geschlechter, also andere Geschlechter. Oder manche denken nur an, so wie es mir manchmal leider passiert, fast nur an das Thema Migrationsgesellschaft. Wer ist denn eigentlich sichtbar, wer nicht weiß, deutsch ist? Und dann gibt es natürlich auch noch das Thema Behinderung. Und auch das ist nicht immer sichtbar. Also es gibt Menschen, die leiden an chronischen Krankheiten oder aber auch haben von der Geburt an bestimmte Behinderungsmerkmale, die man halt nicht sieht auf den ersten Blick, die sie aber prägen. Und so weiter. Dann gibt es auch noch natürlich sexuelle Orientierung, also ob man lesbisch ist, schwul. Und wenn man diese ganzen Sachen betrachtet. Also das ist sozusagen das Ziel. Wenn man Diversität intersektional, heißt es Fachwort, wenn man es so betrachtet und sieht das Menschen eben oft mehrere Merkmale haben. Also ich bin zum Beispiel eine Frau mit Migrationshintergrund, und ich war mal relativ jung, als ich zum Beispiel in einer Führungsposition war. Jetzt bin ich schon 40. Aber damals war ich mit 29 Referatsleiterin in einer Bundesbehörde und habe echt gemerkt, dass zum Beispiel Alter das Merkmal war, das am meisten mich sozusagen gehindert hat. Also die Leute dachten immer, ich sei die Praktikantin und haben mich tendenziell nicht zu ernst genommen. Also externe Menschen, die uns getroffen haben. Und das war zwar irgendwie auch witzig, weil dann gab es immer so ein Überraschungsmoment. Und außerdem haben sie mir dann Sachen erzählt, diese mir vielleicht so nicht gesagt hätten. Also verschiedene Merkmale können eben zusammenrücken. Und deswegen ist es bei Diversität wichtig, dass man das umfassend versteht und erkennt, dass Vielfalt eben bedeutet, dass man ganz verschiedene Menschen mit ganz verschiedenen Merkmalen zusammenholt. Das kann auch so etwas sein wie Armut übrigens, was ein sehr häufiges und sehr, sehr prägendes Merkmal ist. Das kann sich zwar ändern, das ist nicht angeboren, aber Armut kann darüber bestimmen, ob man bestimmte Chancen hat oder nicht.
Daniel Fiene: Lassen Sie uns noch einmal bei dem eben gehörten Fremdwort einhaken. Intersektionalität. In der Medienöffentlichkeit, fällts immer mal wieder. Vielleicht ist Ihnen das schon aufgefallen, und im Kern geht es darum, wenn verschiedene Diskriminierungskategorien eine Person betreffen oder sich in ihr überschneiden. Aber oft wird der Begriff falsch verstanden. Ferda Ataman erklärt den Hintergrund.
Ferda Ataman: Die meisten denken bei Intersektionalität entweder zum Beispiel wir brauchen mehr Frauen. Oder auch mal eine Person mit Behinderung, oder eben auch mal jemand der nicht weiß ist, sondern eine Schwarze Person oder jemand of Colour. Um zu verstehen, dass das ja alles miteinander verschränkt ist und das alles alle betreffen kann. Und eben zum Beispiel bei Frauen ist ein Klassiker, dass man dann junge Frauen sich gerne holt, die vielleicht noch nicht so viel Berufserfahrung haben und dann im Team, die sich nicht so einbringen und nicht stören. So ungefähr. Weshalb ältere Frauen sowohl im Fernsehen, in der Unterhaltungsbranche, aber eben auch oft bei Karrieren gar nicht berücksichtigt werden. Das heißt, dass ist die Verschränkung, dass ist das intersektionale. Viele stellen gerne Frauen ein. Aber zum Beispiel, da gibt es auch Studien, nicht so gerne Frauen um die 30, weil die könnten ja Kinder kriegen und dann die nächsten Jahre ausfallen. So. Und das ist natürlich auch auf den ersten Blick schwer zu verstehen. Auf der anderen Seite ist es eigentlich das ganz normale Leben. Und wenn man sich eben einmal mit möglichen Diskriminierungsmerkmalen beschäftigt. Denn dann versteht man das, glaube ich nach und nach von selbst und kann sogar noch neue, intersektionale Aspekte erkennen, die vielleicht so noch gar nicht im Diskurs in
Daniel Fiene: Das heißt eventuell ist gar nicht unbedingt Mischung die Lösung, sondern das Mindset dahinter zu verstehen.
Ferda Ataman: Nein. Ich glaube, deswegen meinte ich vorhin, dass es so wichtig zu gucken. Was ist das Ziel? Maria Furtwängler und ich, wir beschäftigen uns ja beide mit Medien. Ich mehr mit Journalismus, sie wahrscheinlich mehr, aber auch vor allem mit Film und Unterhaltung. Und bei beidem muss ja das Ziel sein, dass man sagt, man möchte Diversität abbilden. Man möchte die Gesellschaft zeigen. Und dann würde es eigentlich von selbst passieren. Dann würde. Man kann ja gar nicht sagen jemand ist nur Frau, hat aber kein Alter und kein Aussehen oder so. Wenn das Ziel ist, möglichst divers zu werden, dann passiert Intersektionalität in der Regel von selbst. Nur das hat viele noch nicht. Es ist so wichtig, aus der eigenen Bubble rauszukommen und zu erkennen, dass man überhaupt weiß ist, zum Beispiel. Damit man weiß, wenn ich jetzt Frauen einstelle, aber nur weiße Frauen, dann stimmt da halt auch was nicht so auf Dauer.
Maria Furtwängler: Und vielleicht da Daniel nochmal um auf dieses warum, auf das du ja vorhin. Warum soll man das berücksichtigen? Ferda hat ja schon gesagt, dass man es auch machen sollte, um auf der anderen Seite sozusagen ein möglichst diverses Bild journalistisch, breites Spektrum abzudecken, um die Leute auch abzuholen. Und wir von der Stiftung sind ja auch ganz stark aus der Motivation gekommen, weil diese Bilder, die wir sehen. Oder die Texte, die wir lesen. Einfach einen großen Einfluss auf uns haben. Es beeinflusst mich einfach, wenn ich da eine Forscherin zum Thema Kernkraft höre. Das setzt in mir eher eine Fantasie frei, als junge Frau, als Mädchen. Woah krass, so will ich auch mal sein. Wir leben ja stark davon, dass diese Bilder in uns wirken. Und wir uns dann einfach sowas für uns vorstellen können. Und wenn wir eben gerade jetzt. Ich komme nochmal mit der Lösung der großen Probleme, vor denen wir heutzutage stehen. Dann können wir uns nicht mehr leisten auf die Hälfte, wenn man jetzt das Geschlechtsthema anschaut, auf die Hälfte des Braincapitals zu verzichten. Und das gleiche gilt für all die anderen Diversitätskriterien. Wir müssen auch auf Weisheiten von Menschen zurückgreifen aus ganz unterschiedlichen Backgrounds und Erfahrungsinhalten. Es gibt so starke Beispiele, die uns einfach gezeigt haben, wie stark diese Bilder wirken. Es gibt eine Untersuchung in Amerika, wie viele Frauen, die heute in der Wissenschaft arbeiten, beeinflusst sind. Ich glaube 65 Prozent haben erzählt, dass die Serie, die es damals mal gab – Akte X, mit Scully, einer starken Forensikerin in dieser Serie. Eine der frühen, starken, wissenschaftlich arbeitenden Held*innenfiguren, dass die da mitgeprägt hat und inspiriert hat selber in die Wissenschaft zu gehen. Oder man in Amerika gesehen hat, dass nachdem diese Filme wie „Tribute von Panem“ wo Katniss, also mit dem Pfeil und Bogen beinahe die Welt gerettet hat. Oder „Merida“, dieser Comicfilm, Animationsfilm. Die auch mit Pfeil und Bogen war. Dass daraufhin über 60 Prozent Zuwachs war von Mädchen, die Bogenschießen lernen wollten. Und diese Bilder prägen uns. Und wir brauchen mehr diverse Menschen, die sich von Bereichen angezogen fühlen, die bisher zu stark ausschließlich männlich, weiß korreliert sind. Das ist der Grund vielleicht. Und dann vielleicht in dem Zusammenhang Daniel. Etwas, was ich vielleicht ganz wichtig finde, wir müssen auch nicht nur über Frauenbilder und die bestimmten Erzählungen von Frauen. Oder auch von Homosexuellen, oder von People of Colour, die dann bestimmte stereotype Rolle spielen, durchbrechen. Sondern wir müssen auch über Männlichkeitsbilder reden. Und ich finde das wird im Moment viel zu wenig getan. Ich finde das ist viel zu wenig Thema. Was sind eigentlich die einschränkenden Rollenbilder denen Männer heute unterliegen? Die aber auch ganz stark etwas damit zu tun haben, wie wir heute auf die Welt schauen. Auch wie wir sozusagen in welcher ausbeuterischen Art wir auf unsere Welt und Zukunft schauen. Und ich glaube, dass hat viel mit dem was dann im Extremen die sogenannte toxische Männlichkeit ist, zu tun. Und ich denke wir sollten vielmehr auch über Männlichkeitsbilder reden und die nicht nur sozusagen, ich sag jetzt mal die schwächeren bedienen, denen man jetzt endlich mal mehr Platz geben muss.
Daniel Fiene: Aber wenn wir jetzt auch gerade die Männlichkeitsfrage mal so in die Zukunft denken. Hat das was damit zu tun, wie unsere Kinder heute oder die Jungs heute, in welcher Gesellschaft sie aufwachsen, aber auch, was sie beigebracht bekommen. Oder?
Maria Furtwängler: Man muss sich mal vorstellen, nach wie vor. Es ist eigentlich kein Problem, aber vielleicht ändert sich ja das langsam. Aber eigentlich kein Problem. Wäre jetzt meine Tochter, mal angenommen, ich hatte heute eine Tochter mit acht Jahren, und die sagt: hier ich will nur Hosen, und ich will eigentlich ein Junge sein, und ich schneid mir die Haare kurz und so. Und also alle sozusagen in Anführungsstrichen männlichen Insignien, das ist eigentlich kein Problem. Aber wehe dem, ich habe ein Bub mit acht Jahren. Ich sage es mal acht oder zehn Jahre, was auch immer, der halt wahnsinnig gerne sich die Nägel lackiert, der sich gerne auch mal ein Röckchen überzieht, der auch mal gerne Rosa anzieht. Da wird getuschelt, nicht nur von den anderen Müttern, sondern es ist immer noch so, dass das die weiblichen Insignien, das sind die der Schwäche. Das sind immer noch, wenn ich mir die anziehe, wenn ich mich interessiere für Nagellack und für dieses oder für jenes, dann interessiere ich mich für etwas, was irgendwie nicht so richtig ernst zu nehmen ist. Und wir nehmen das so hin, diese selbstverständliche Minderwertigkeit das weiblichen Geschlechts ist. Nehmen wir so hin. Und daran finde ich, eben weil du sagtest mit Kindererziehung, das ist ein Grundproblem. Das fängt damit an mit Blau und Rosa, und das ist völlig okay. Wenn das Mädchen blau anhat aber der Bub rosa, schwierig.
Daniel Fiene: Ich habe gerade in den letzten 2 Minuten drüber nachgedacht. Wie divers bin ich eigentlich wirklich eingestellt? Das kann ich über mich selbst vielleicht in dem überprüften, indem ich mir mal so das Szenario einmal durchspiele. Nach außen gebe ich mich da vielleicht tolerant und finde es toll und unterstützt da auch viel. Aber wenn es dann die eigenen Kinder betrifft, reagiere ich da anders? Und wenn ich dann anders reagiere, ist das vielleicht ein Zeichen, dass ich da auch noch ein bisschen selber dran arbeiten kann. Also das dieser Weg nicht abgeschlossen ist, oder?
Maria Furtwängler: Nein, das ist. Für mich Daniel, ist das immer so ein ganz wichtiger Punkt. Dass wir da, im Gegenteil eher sagen: Wow, ja, ich bin da. Ich muss da, damit mein Sohn und ich habe gelernt. Ich muss ganz entspannt sein, wenn er das Tütü anzieht und Nagellack sich drauf tut. Und sagen Nein, es ganz prima, aber innerlich kriege ich Schweißausbrüche. Dann kann ich nur sagen: ja, ich bin das Produkt dieser patriarchalen Gesellschaft und es macht vor mir nicht halt. Und meine Motivation, so in diese ganze Debatte mit einzusteigen, ist freilich meine eigenen Vorurteile. Die mir so unfassbar um die Ohren geflogen sind, weil ich eben dauernd spüre, wie ich auch eine verinnerlichte, dezente Verachtung für Frauen habe. Wie ich habe ja immer dieses wirklich krasse Beispiel, was sich jetzt schon hundertmal erzählte. Aber ich erzähle es noch mal. Wie ich zum ersten Mal, 15 Jahre schon her, im Flieger saß, von München nach Berlin und plötzlich eine Kapitänin sprach und sagt: meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich flieg sie jetzt nach Berlin und ich nur mein Reflex war scheiße, wie komme ich hier raus und ich nur schockiert von mir selber war. Ich dachte aber Maria, natürlich kann das eine Frau. Ja, ja, intellektuell. Und ich bin für Gleichberechtigung und alles. Aber noch nicht, wenn es an sozusagen diesen Moment der Ohnmacht, nämlich des Fliegens, geht. Da habe ich doch keine Frau im Kopf, die ein Flugzeug steuern kann. In jedem amerikanischen Spielfilm waren das immer Männer, die in letzter Sekunde durch den Sturm das Ding noch gelandet haben. Und in jedem Kinderbuch sind Männer. Also ich bin doch ein Produkt dieser Gesellschaft. Und wenn ich hinter einem Auto in erfahre und es tritschelt, denke Frau am Steuer. Ich bin doch voll selber davon. Und dann fahre ich daran vorbei. Dann sitzt da ein Mann und ich denke naja Wurst. Und wenn es eine Frau ist, denke ich na siehste. Ich bin doch ein Produkt. Ich bin doch groß geworden mit dem siebten Sinn, wo mir ganz selbstverständlich erzählt wurde, dass Frauen halt so doof sind und in den Rückspiegel gucken und ihn als Schminkspiegel vertun oder dass sie eben auch nicht einparken können. Ich bin doch so geprägt. Und ich kann das doch nicht, weil ich heute sage - ich war in einem Diversität Seminar - einfach ablegen. Sondern ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir uns von diesem Bewusst werden. Dass ich mir bewusstwerde, sowohl meiner Voreingenommenheit gegen Frauen, meines Rassismus, meine verinnerlichten. Es ist doch viel wertvoller, wenn ich das eingestehe. Und wenn ich dann damit wirklich umgehe, weil ich weiß, ich habe diese Reflexe in mir. Und das wäre viel aufrichtiger als zu sagen: Nein, ich bin und ich kenne überhaupt kein rassistischen Ressentiments. Nein, und ich habe das beste Argument über von Männern typischerweise: Ach, ich bin so feministisch. Ich habe drei Töchter, wo ich denke, na ja, die letzten ja Generationen hatten auch Töchter und waren deshalb nicht unbedingt feministisch.
Ferda Ataman: Ich finde es einen ganz wichtigen Punkt, weil das auch damit zu tun hat, dass man sich zum Beispiel schämt. Oder dass man so ein Schamgefühl hat wenn man merkt oh, ich habe jetzt was gedacht oder auch gesagt, was eben eigentlich ja nicht okay ist. Weil wir wollen ja alle irgendwie für Diversität und Gerechtigkeit sein. Und die Scham bringt uns überhaupt nicht weiter. Dann würde wieder die Frage helfen: wofür machen wir das denn eigentlich? Wir machen das ja nicht, um Recht zu haben oder damit einzelne sich irgendwie besser fühlen und andere das Gefühl haben, sie machen was falsch. Sondern das Ziel ist doch, dass wir lernen, dass manches, was wir bisher gelernt haben - deswegen kann man dieses Thema nicht ohne zurückblicken machen - falsch ist. Also zum Beispiel, dass Frauen tatsächlich alles können, dass das nicht nur so eine Redewendung ist, sondern eben auch Realität sein kann. Oder dass vieles, was wir gelernt haben, tatsächlich noch vom Kolonialismus geprägt ist. Das ist etwas, was viele überhaupt nicht wissen. Aber wenn ich mir bestimmte Filme angucke, die irgendwie mit Reisen und Südsee und Pazifik zu tun haben und die ganzen Schwarzen Menschen dort kommen, nur in einer Hula-Hula Situation, wo sie tanzen oder irgendwie gerade jemanden bedienen, vor, dann muss mir klar sein oder dann lernt man eben nach und nach, dass das nicht so sein muss. Und das Schwarze Menschen auch in der Managerposition vorkommen können und das Hotel leiten können. Selber als Tourist*innen dahin können und so weiter. Und das ist ein Prozess. Deswegen hätten wir es ja vorhin noch gesagt. Das muss man halt lernen und sich nicht schämen, sondern genau, wie es Maria Furtwängler gesagt hat, einfach wahrnehmen und dann überlegen, wie man vielleicht dran arbeiten kann.
Daniel Fiene: Aber was können wir alle heute tun, um schon jetzt die Grundlage zu legen, damit wir in Zukunft die positiven Seiten der Vision der beiden Gästinnen erleben können? Nicht die negativen. Darum soll es jetzt im nächsten Teil gehen. Vor zwei Jahren, da hat KiKA die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Die kommt von der Initiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen. Da geht es um die Ziele eines vorurteilsfreien Arbeitsumfeldes und was mich freute bei der Frage, was wir alle eben heute tun können, um in 25 Jahren eine diverse Gesellschaft zu ermöglichen, haben beide als erstes über die Rolle des KIKA geredet.
Ferda Ataman: Ich finde KiKA macht da schon einiges richtig. Also wenn ich das Programm mir angucke, was ich total gerne mache übrigens. Und auch die Kindernachrichten, zum Beispiel „Logo!“, mir angucke oder so. Dann sehe ich da viel mehr Diversität, als ich sie bei der „Tagesschau“ oder im „heute journal“ sehe. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir wahrnehmen müssen, dass Kinder auch oft schon weiter sind und sie darin einfach lassen. Vieles, was wir heute hier besprochen haben, ist für viele Kinder und Jugendliche selbstverständlich. Ist aber in der Arbeitswelt da, wo die entscheidenden Personen sitzen und so weiter, gar nicht so selbstverständlich. Deswegen reden wir noch so viel darüber. Und ich glaube und hoffe immer, wenn man mehr Kinder hat und Jugendliche, für die das selbstverständlich ist, dann sind wir auf einem richtig, richtig guten Weg. Das sind natürlich nicht alle, aber ich glaube schon, dass ganz viel es als völlig normal empfinden das deutsche Kinder eben auch Osman und Goran und Fatma Ja, also für dies ist das völlig klar. Und wir müssen das immer noch dazu sagen. Das können aber auch deutsche Kinder sein, so diese Ungleichzeitigkeiten. Wenn wir diese ein bisschen überwinden, dann wird es schon besser.
Maria Furtwängler: Ich glaube das wir uns selber bewusst werden. Eins, dass wir nicht total woke sind. Und es auch nicht sein müssen. Und es auch nicht sein können. Und dass es deshalb sinnvoll ist, egal ob es Checklisten sind. Ob es einfach Verfahren sind, diesen sogenannten unconcious bias, denn wir einfach mitbringen, weil wir in dieser, unserer Gesellschaft groß geworden sind. Einfach ein Stück weit raus nehmen aus gewissen Entscheidungsmomenten. Ich glaube das ist so für mich das wichtigste Takeaway. Sei dir bewusst, dass du aus der patriarchalen Struktur, in der du groß geworden bist, Gesellschaft, in der du groß geworden bist, nicht frei davon bist. Also wie gesagt frei von rassistischen, unterschwelligen Gedanken und Ideen. Sondern dass du das hast und das es eben sinnvoll ist da selber zu schauen und zu überprüfen. Ich kann nur anschließen. Ich glaub der KiKA macht da schon einiges sehr gut. Ihr habt euch ja eine Checkliste gegeben. Da hat sich ja auch einiges bewegt, wir haben das ja auch noch einmal nachgezählt in der AV-Div 2, audiovisuelle Diversitätsstudie 2. Wo wir auch noch einmal gezählt haben, wie ist das jetzt letztes Jahr im gesamten Fernsehjahr so ungefähr gewesen. Man sieht da Bewegung. Auch beim KiKA. Ich glaube nach wie vor auch der KiKA tut sich da ein bisschen schwer. Oder eben die ganzen Kindersender, wenn es darum geht genügend Expert*innen in die Sender zu bekommen. Wenn es also um Information geht, ist da noch Nachholbedarf. Und natürlich auch in der Art wie Frauenfiguren erzählt werden. Aber ich glaube ihr macht das schon mal sehr gut. Ich glaube Checklisten helfen.
Daniel Fiene: Vielen Dank für das Lob beider, auch Maria, auch für die Anregungen. Ferda - du sagst es auch KiKA macht schon einiges richtig. Andersherum gefragt was macht KiKA denn noch nicht so gut?
Ferda Ataman: Ich würde mir wünschen, dass es auch hinter den Kulissen, sozusagen, also in den Redaktionen diverser wird. Da habe ich zumindest so weit, wie ich das mitbekommen, habe den Eindruck das zwar vor der Kamera doch darauf geachtet wird, dass da diverse Menschen zu sehen sind. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das hinter den Schreibtischen auch der Fall ist. Und das ist super wichtig, weil das natürlich Perspektiven sind, die auch bei der Redaktionsplanung ganz wichtig sind. Und vielleicht noch, das hatten alle Untersuchungen gezeigt, die MaLisa-Studie und aber auch unsere Untersuchung. Wir haben auch mal gezählt, wer so sichtbar ist. Menschen mit Behinderungen sind einfach super selten im Fernsehen zu sehen. Und das kann KiKA mit bestimmt auch besser machen.
Daniel Fiene: Aber den Punkt, den du gerade gesagt hast Ferda. Das ist, glaube ich, auch etwas, was grundsätzlich neue Herausforderungen im Journalismus ist. Und die Frage: Reicht es eigentlich, wenn die Moderator*innen divers sind? Reicht es eigentlich aus? Aber Maria: Wie ist denn das im Bereich der Fiktionalität? Haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Aber was könnten da so ganz nächste, konkrete Schritte sein, dass uns da weiterbringt?
Maria Furtwängler: Dazu haben wir jetzt kürzlich noch eine Untersuchung gemacht über geschlechtsspezifische Gewalt und Darstellung in den audiovisuellen Medien. Also im Grund Gewalt gegen Frauen, wie wir die eigentlich dargestellt? Und in welchen Kontext? Und da ist auch etwas aufgefallen. Also das kommt überraschend häufig vor. Manchmal wird das auch benutzt, um die Spannung herzustellen. Und es ist wenig reflektiert. Es wird nicht der strukturelle Kontext zum Beispiel von Gewalt gegen Frauen erwähnt. Was ein Problem ist. Es gibt dann im Anschluss keine Hilfeangebote. So wie es selbstverständlich ist bei Filmen über Suizid. Aber das ist ein Problem. Aber apropos. Ich glaube das Durchbrechen von stereotypen Narrativen ist etwas das Medienmacher*innen angeht ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube es ist ein sehr beliebtes Narrativ. Apropos Gewalt gegen Frauen ist die ermordete, entführte, ja verschwundene Frau um die Heldenreise des traurigen, wütenden Mannes zu begründen. Und wenn ich sozusagen dieses Narrativ als Hülle habe und uns fallen sofort drei, vier Filme ein, wo sozusagen damit der Film losgeht. Die Frau, doll geliebt und so weiter. Sie ist verschwunden. Sie ist ermordet worden, zerstückelt worden. Irgendetwas. Jetzt ist der Mann on his journey. Und jetzt folgen wir sozusagen dem Mann. Also die Gewalt gegen die Frau wird nur als Plotpoint benutzt, um zu begründen, dass der traurige Mann jetzt losgeht. Und das sind so Dinge, so Selbstverständlichkeiten, an die wir uns gewöhnt haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel, wo ich sage, da müssen wir einfach noch mal anders drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist jetzt einfach ein Beispiel, wo wir in so bestimmte stereotype Muster immer wieder verfallen. Ah ja, weil das funktioniert ja und so geht das ja. Da einfach wachsamer zu werden, sich fortzubilden und zu gucken, wie könnte man eigentlich Geschichten und so auch anders erzählen.
Daniel Fiene: Wie haltet ihr auch beide euch zum bei dem Thema Diversität selbst auf dem Laufenden? Habt ihr da noch so einen persönlichen Trick oder eine persönliche Empfehlung, die man sich vielleicht abgucken kann?
Ferda Ataman: Ich lerne meistens in Gesprächen mit anderen Initiativen oder Aktivist*innen oder Leuten, die sich damit beschäftigen. Also Expert*innen. Und meistens tatsächlich aus den verschiedenen Bereichen. Also ich habe in den letzten, ja Jahren oder vor allem Monaten wirklich lernen müssen, nicht behindertenfeindlich zu sprechen. Also vieles, was man sagt: wie Boah, ist das total dumm? Oder so, dass das für Menschen, die nicht so intelligent auf die Welt gekommen sind. Wir sind alle unterschiedlich intelligent. So ist das nun mal. Das man, dass zum Beispiel nicht sagen muss, das musste ich lernen. Und mir hilft es total, wenn Leute mir das dann erklären. Deswegen erkläre ich es auch anderen immer wieder gern, was so alles rund um Einwanderungsgesellschaft angeht und gehöre nicht zu denen, die dann total genervt sind und finden: Nein, äh, lies dir das doch selber bei Wikipedia an. Ich habe keine Lust, das zu erklären. Sondern ich finde, wir können uns gegenseitig da in Gesprächen total freundlich, zugewandt, gegenseitig weiterhelfen. Das finde ich, finde ich immer super hilfreich.
Daniel Fiene: Maria, wie ist es bei dir?
Maria Furtwängler: Also ich finde tatsächlich den Austausch gut. Wie gesagt bei uns mit der Stiftung. Ich bin ein Zahlennerd. Sozusagen ursprünglich aus der Wissenschaft, ich habe mal Medizin studiert. Ich bin Ärztin sozusagen, unsinnigerweise. Also nicht unsinnigerweise. Ich bin es halt immer schon. Das es sinnvoll ist so einem Bauchgefühl Fakten und Zahlen gegenüberzustellen. Und ich glaube das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich glaube das es alles lösen kann. Gar nicht. Ich glaube auch nicht dass es alles erklären kann. Aber ist es ein kraftvolles Tool, um bestimmte Missstände und Probleme sehr nüchtern zu betrachten. Also das hat mir immer wieder geholfen. Ich glaube das hat sozusagen auch die Arbeit der Stiftung relativ stark hervorgehoben. Es ist kein Allheilmittel. Aber es ist etwas, was immer wieder hilft, um eine Diskussion zu objektivieren. Und eine Handlungsnotwendigkeit auch nochmal offensichtlicher zu machen.
Daniel Fiene: Und deswegen sage ich ganz herzlichen Dank, dass wir jetzt dieses Gespräch führen konnten, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Das hat da echt noch einmal einige Perspektiven auch eröffnet. Danke schön.
Maria Furtwängler: Danke, sehr.
Ferda Ataman: Sehr gerne.
Daniel Fiene: Jeder Schritt zählt und auf die eigenen kommt es an. Das nehme ich persönlich mit. Und dann gab es auch noch einiges zum Nachdenken. Ich hoffe für Sie auch. Und damit endet auch unser Blick auf die Generation Alpha und die Diversität. Alle zwei Wochen können Sie eine neue Folge hören. Sie finden Sie in der ARD Audiothek, in gut sortierten Podcast Apps und Verzeichnissen sowie im KiKA Kommunikationsportal. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Daniel Fiene. Bis zum nächsten Mal bleiben auch Sie mit uns neugierig auf die
[Outro]: Generation Alpha - Der KiKA Podcast
Zuletzt geändert am [ 16.03.2022 ]